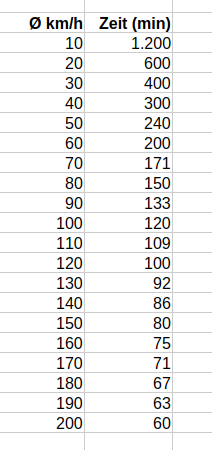Nach dem weißnichtmehrwievielten Anlauf habe ich jetzt endlich mal die Story von Red Dead Redemption 2 durchgespielt.
Ich hatte RDR2 schon auf der XBox One und habe das auch bis zur Mitte von Kapitel 3 („Clemens Point“) gespielt, aber dann kam Frühling und Sommer, und irgendwie hatte ich besseres zu tun.
Jetzt also noch ein Anlauf auf dem PC.
Ich habe nie den Anspruch, in Spielen wirklich jede Sidequest zu absolvieren, wollte aber auch nicht durch die Story hetzen, das wäre dem Spiel gegenüber nicht angemessen. Daher habe ich meistens die weißen Markierungen (Sidequest) gespielt, bis erstmal keine mehr übrig war, um mich dann mal wieder an eine gelbe Markierung (Story) zu begeben. Wenn unterwegs durch Zufall eine Begegnung mit NPCs stattfand, habe ich die jeweilige Sidequest auch verfolgt. Aber eben nicht alle, ich wollte ja auch mal fertig werden.
Was mit Arthur Morgan passieren würde, wusste ich bereits, das lässt sich ja kaum vermeiden, wenn man auch nur manchmal auf YouTube unterwegs ist.
Ich hatte erst 75% des gesamten Spiels erschlossen, aber nachdem ich nun alle Storymissionen erledigt hatte und der halbstündige Abspann vorbei war, sank meine Motivation, noch weiter in der Spielwelt herumzureiten, schlagartig auf Null.
Ich kann also mit ziemlicher Sicherheit für mich feststellen, dass für mich an einem Computerspiel die Story den allergrößten Anreiz bildet, es zu spielen. Keine Story – kein Interesse.
Was mich zum nächsten Spiel bringt, das ich in letzter Zeit ausprobiert habe, einfach, weil es in aller Munde war: Arc Raiders.
Bevor ich lange aushole und versuche, die Faszination zu beschreiben, die das Spiel auf viele ausübt, verweise ich gerne auf Steffen, der das in seinem Blog kaffeeringe.de schon ganz wunderbar gemacht hat.
Tatsächlich war sein Artikel einer der Gründe, mich doch mal mit Online-Gaming zu beschäftigen, ein Genre, das ich bisher eher gemieden habe. Irgendwie hatte sich in meinem Hinterkopf dieses Bild von pubertierenden Teenies festgesetzt, die sich gegenseitig über den Haufen ballern und dabei mit ihren brüchigen Stimmchen in ihr Headset brüllen, dass sie des anderen Mutter penetrieren.
Arc Raiders sollte anders sein, hieß es.
Ich kaufte das Spiel also, spielte ein paar Runden, aber ach, ich werde mit dieser Art von Spielen einfach nicht warm. Es besteht immer die Möglichkeit, in dieser Runde erschossen zu werden (und sei es von den ziemlich fiesen KI-Gegnern), und das alles ist mir einfach zu aufregend.
Eine nennenswerte Story bietet ein Online-Extraction-Shooter logischerweise auch nicht, außer „Repariere mal so eine Antenne, ist wichtig“ kommt da natürlich nicht viel, immerhin ist man ja mit lauter anderen Spielern an der Oberfläche.
Ich will Arc Raiders gar nicht schlechtreden, das ist wirklich gut gemacht, und auch ich hatte bereits Erlebnisse, bei denen ich im Kampf gegen die Maschinen anderen helfen konnte, die sich hinterher bei mir bedankten.
Aber ich bin nach jeder Runde so aufgeregt, dass ich erstmal eine Weile Pause machen muss. Ich verstehe gar nicht, wie andere das über Stunden Runde um Runde aushalten. Vielleicht fehlt mir da auch einfach der kompetitive Ansatz, denn ich habe gar nicht den Anspruch, diese ganzen Bewegungsabläufe zu trainieren, um besser zu werden. Mich stresst das eher.
Stress aber habe ich im Alltag schon genug, ich spiele, um mich zu entspannen.
Jetzt muss ich mal schauen, welches Spiel ich als nächstes angehe, ich habe ja noch einen ganzen Stapel davon in meiner Steam-Bibliothek.
Der erste Teil von Red Dead Redemption wird’s wohl nicht werden, den habe ich nochmal angespielt, aber der ist mir im Vergleich zum Vorgänger dann doch etwas zu altbacken.
Ich habe blöderweise die Angewohnheit, irgendwann mal angespielte Titel nicht fortzusetzen, sondern von vorne zu beginnen, weil ich mir weder die kurz angerissene Story noch die Button- bzw. Tastenbelegungen merke. Ghost of Tsushima hatte ich ja auch angespielt, aber das war mir dann auch zu repetitiv, man reitet irgendwo hin, da sind dann Gegner, dann drückt man alle Buttons, die der Controller hat, in beliebiger Reihenfolge, und wenn alle tot sind, reitet man weiter. Sieht schön aus, aber: Meh.
Egal, irgendwas werde ich schon finden. Tipps werden gerne entgegengenommen.