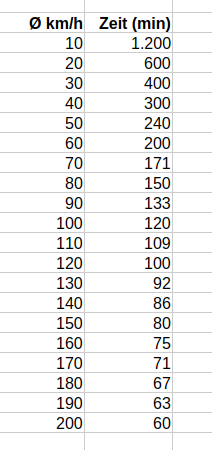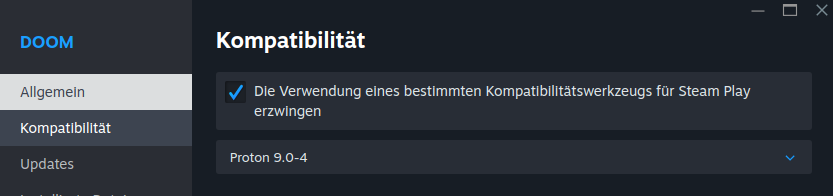Ich habe in den vergangenen Wochen (wieder einmal) verschiedene Musik-Streamingdienste ausprobiert und bin letzten Endes doch wieder bei Spotify gelandet.
Grundsätzlich verstehe ich ja die Kritikpunkte an Spotify, als da wären:
- die mangelhafte Vergütung der Künstler
- die Investitionsaktivitäten des CEOs
- die KI-generierten, nicht als solche gekennzeichneten Stücke im Katalog
- die Gebührenerhöhung
- die Werbung für faschistoide US-Behörden
Vielleicht habe ich auch noch was vergessen. Bevor wir aber die Punkte mal der Reihe nach durchgehen, will ich allerdings auch die positiven Merkmale aufführen, die für mich so schwerwiegend sind, dass ich mich zum Schluss vorerst doch wieder für Spotify entschieden habe:
- deutlich besserer Empfehlungsalgorithmus
- bessere Benutzeroberfläche
- nativer Linux-Client
- Gewohnheit
Positives
(+) Empfehlungsalgorithmus
Spotify schlägt mir, im Gegensatz zu anderen Diensten, selten Musik vor, mit der ich nichts anfangen kann, denn ich höre wahrscheinlich eher nischige Sachen. Gerade Dienste, die auf kuratierte Genre-Listen setzen wie Qobuz oder Apple Music, liegen bei mir einfach ständig daneben. Ja, ich höre (viel) Metal, aber nein, ich will weder Metallica, noch Slipknot geschweige denn Rammstein hören. Diese Mainstream-Bands interessieren mich einfach nicht. Tidal hingegen schlägt mir dauernd HipHop vor, die einzigen, die neben Spotify noch einigermaßen richtig liegen, sind Deezer.
Bei Spotify bekomme ich immer wieder auch mal sehr kleine, relativ unbekannte Bands vorgeschlagen, von denen manche mittlerweile zu meinen Lieblingsbands gehören. Russian Circles, Urne oder Wheel hätte ich wahrscheinlich ohne Spotify nie entdeckt. Das habe ich mit dieser Trefferquote bei keinem anderen Dienst bisher erlebt.
(+) Benutzeroberfläche
Bei Spotify kann ich durch meine gespeicherten Alben von Anfang bis Ende durchscrollen, ohne dass zwischendurch wieder ein Schwung nachgeladen werden muss. Das ist mir tatsächlich relativ wichtig, weil ich so einfach nach „Zuletzt gehört“ sortieren kann, um dann zum Beispiel ins untere Drittel zu scrollen und mal wieder ein Album hören kann, das ich länger nicht mehr gehört habe.
Insgesamt ist die Oberfläche für meine Begriffe deutlich responsiver und vor allem intuitiver bedienbar.
(+) Linux-Client
Ich höre gerne Musik, während ich an meinem privaten PC sitze, und der läuft nunmal mittlerweile unter Linux. Wenn ich zu Hause am Schreibtisch sitze, will ich nicht per App meine Musik starten müssen.
Wobei die PWAs bei den meisten Diensten auch ganz ok sind. Außer bei Qobuz, da lief irgendwie nichts so richtig rund.
Aber nur Spotify hat – soweit ich weiß- momentan einen eigenen, vollwertigen Linux-Client. Es gibt (inoffizielle) Ansätze für Deezer, aber die können kaum mehr als die PWA oder haben andere Unzulänglichkeiten.
(+) Gewohnheit
Der Rest der Familie benutzt ebenfalls Spotify, und ratet, wer dann dafür zuständig wäre, alle Playlisten und Favoriten auf einen anderen Dienst zu übertragen? Ja, dafür gibt es Hilfsmittel, aber dann muss ich wieder mit neuen Konten herumjonglieren, und eigentlich bin ich ganz froh, wenn ich in meiner Freizeit nicht auch noch dauernd Systemadmin spielen oder Überzeugungsarbeit leisten muss.
Negatives
(-) Mangelhafte Künstlervergütung
Andere Anbieter zahlen pro 1000 Streams mehr an die Künstler*innen aus, weiß ich, aber: Spotify hat mir schon wirklich viele, mir vorher unbekannte Künstler vorgeschlagen, die dadurch auf andere Weise von mir Geld bekommen haben.
Ich gehe häufig auf Live-Konzerte, ich kaufe dort und online Merch, ich bestelle Alben auf Vinyl, und ich kaufe gelegentlich auch Digitalalben über Bandcamp.
Im Schnitt gebe ich im Monat nochmal deutlich mehr für Musik aus, als ich für Spotify bezahle, und das sehr oft, weil ich überhaupt erst durch Spotify in Kontakt mit diesen Bands gekommen bin.
Und mal ehrlich: Das Lamento, dass die Künstler von den verkauften Tonträgern kaum etwas abbekommen, höre ich mir schon seit Erfindung der CD an.
Ich spiele selber auch in einer Band, ich verdiene damit nichts, sondern mache das, weil ich Bock drauf habe, live vor Leuten zu spielen und einen schönen Abend zu haben. Wenn es dir als Künstler keinen Spaß mehr macht, weil am Ende des Monats nicht die Kasse klingelt, mach halt was anderes.
(-) Der CEO investiert in ein Rüstungsunternehmen…
…, das in Deutschland sitzt und dessen Produkt die Verteidigung der Ukraine unterstützt. Damit kann ich leben.
(-) KI-generierte Stücke im Katalog ohne Kennzeichnung
Finde ich nicht gut, betrifft mich aber nicht. Ich habe es anderswo schon mal geschrieben:
„Wenn Spotify es schafft, Dir KI-generierte Musikstücke unterzujubeln, ohne dass Du es merkst, ist vielleicht nicht nur Dein Streaminganbieter, sondern auch Dein Musikgeschmack fragwürdig.“
Ich höre noch dazu praktisch niemals irgendwelche fremden Playlists, sondern nur komplette Alben von real existierenden Bands.
(-) Gebührenerhöhung
Ja, doof, alles wird teurer. Deezer wäre qualitativ (also vom Gesamtfunktionsumfang mit Empfehlungen und allem) gleichauf, ist aber im Familienabo noch teurer als Spotify.
Ginge es mir nur um den Preis, müsste ich zu YouTube- oder Amazon-Music wechseln, weil ich da eh schon zahlender Kunde bin. Aber das fühlt sich auch alles irgendwie falsch an, das wäre zumindest kein ethischer Gewinn.
(–) Werbung für ICE
Das ist richtig Kacke, zugegeben. Und das ärgert mich auch.
Die Post-Rock Band „Godspeed You! Black Emperor“ hat daraufhin ihren gesamten Katalog von Spotify zurückgezogen. Allerdings auch von allen anderen Streamingplattformen, vielleicht hatten sie das eh schon vor, und das war nur der Tropfen, der bei denen das Fass zum Überlaufen brachte. Ich habe mir dann vier Alben von ihnen bei Bandcamp nachgekauft.
Vielleicht müssten ein paar größere Acts nachziehen, damit es Spotify wehtut.
Fazit
Ich hätte gerne einen besseren, ethisch weniger fragwürdigen Musikstreamingdienst mit (für mich) gleicher Leistung zu ähnlichem Preis.
Den habe ich aber noch nicht gefunden. Ich bleibe auf der Suche. Aber für mich und mein Musikkonsumverhalten wäre der Verlust bei einem Weggang von Spotify zum jetzigen Zeitpunkt zu groß.
Und so bleibe ich vorerst Spotify-Kunde, zähneknirschend.